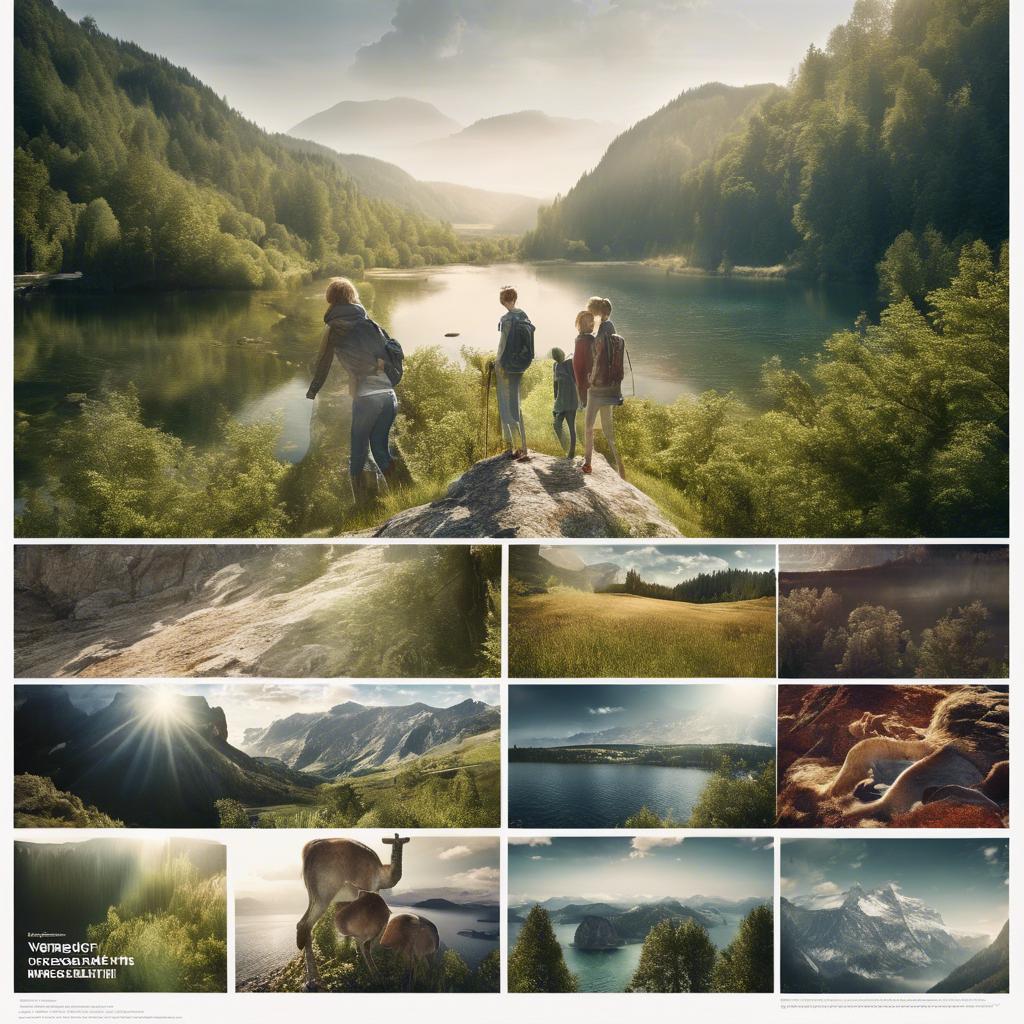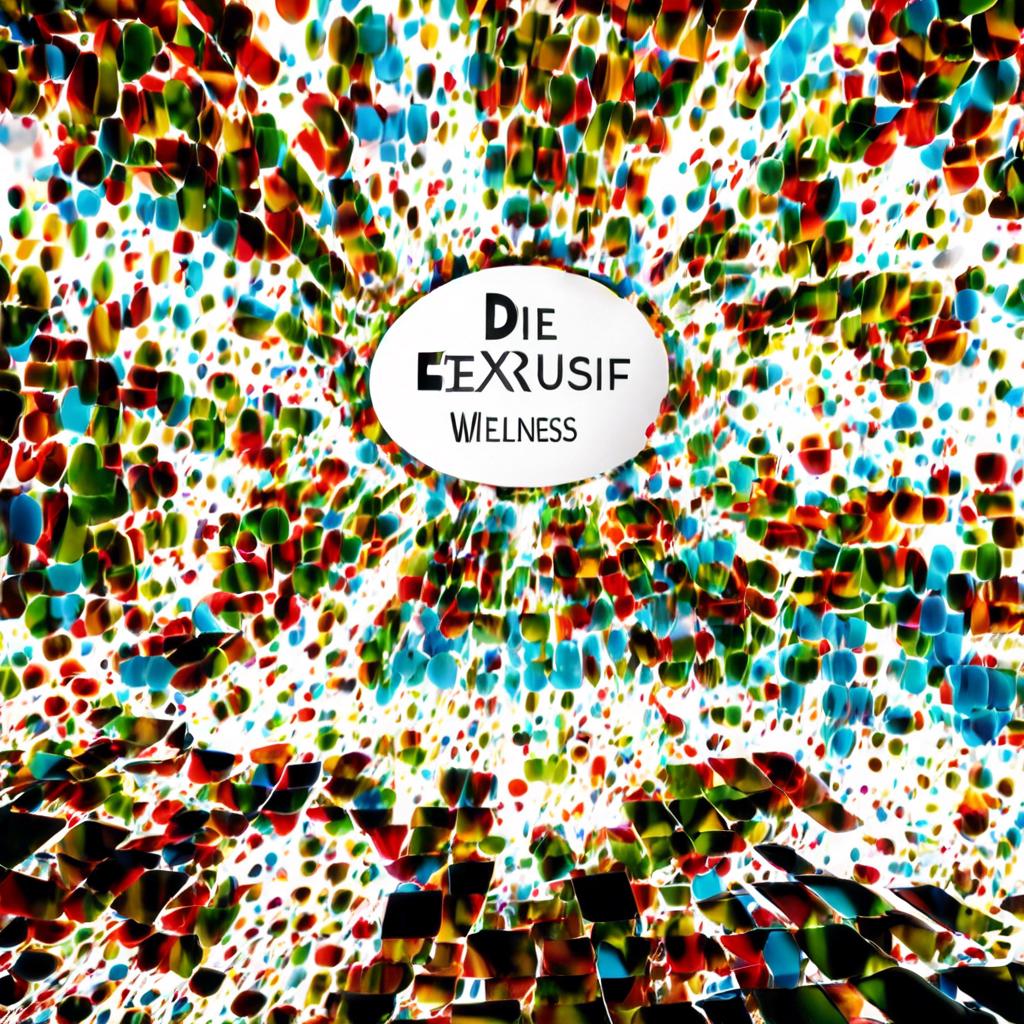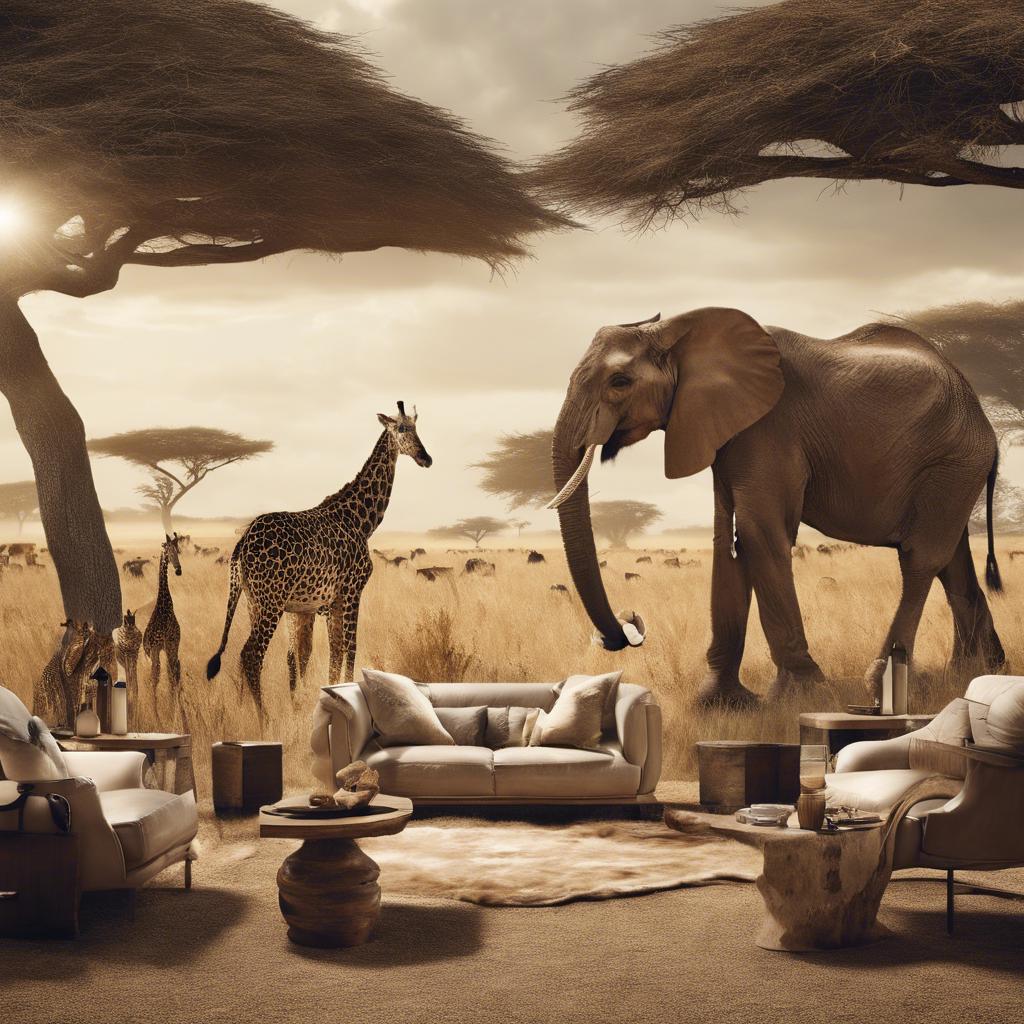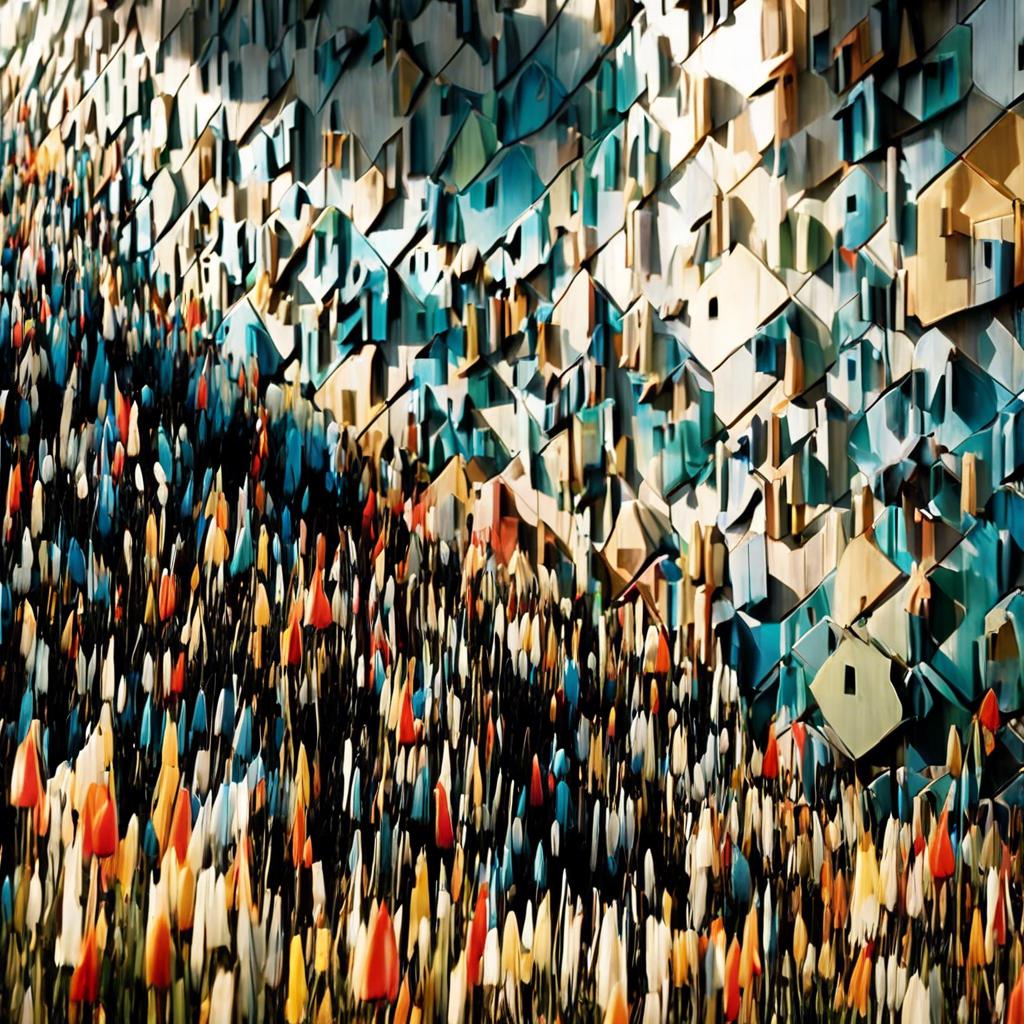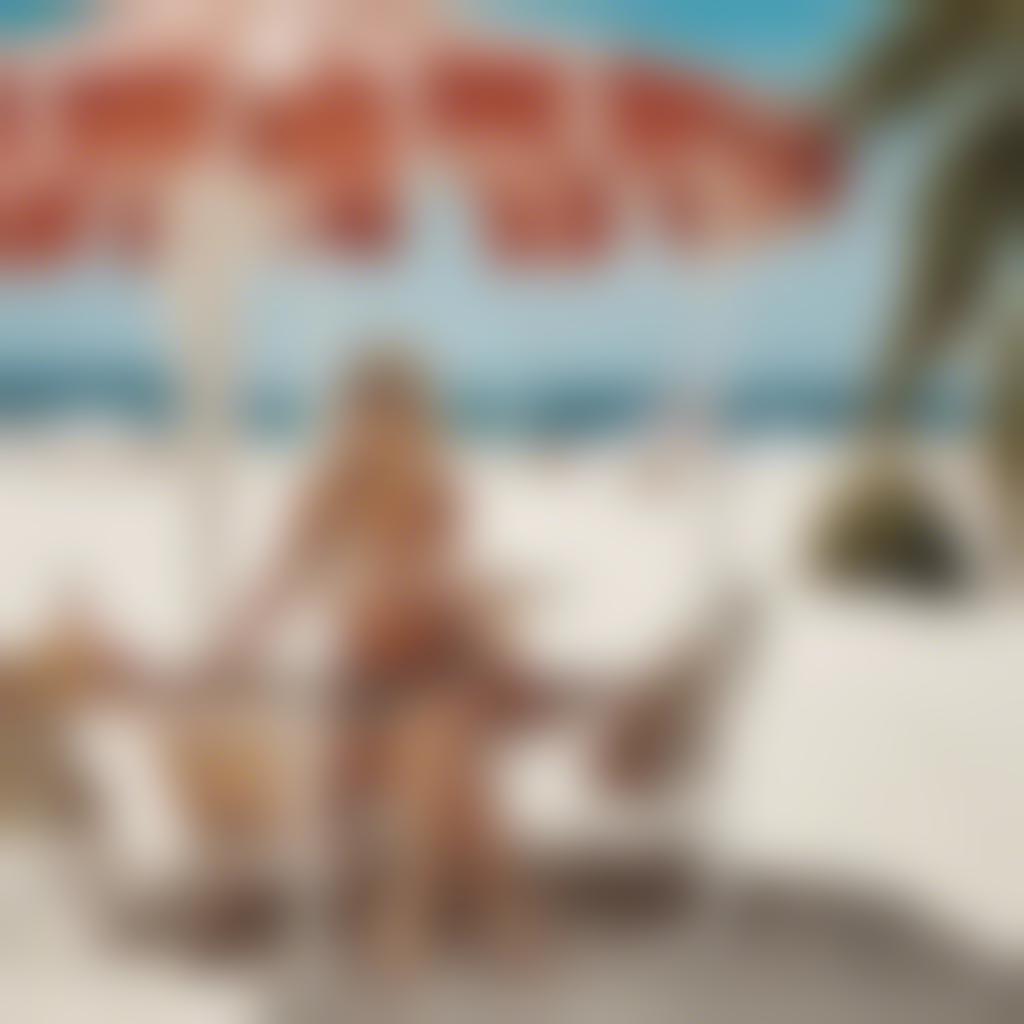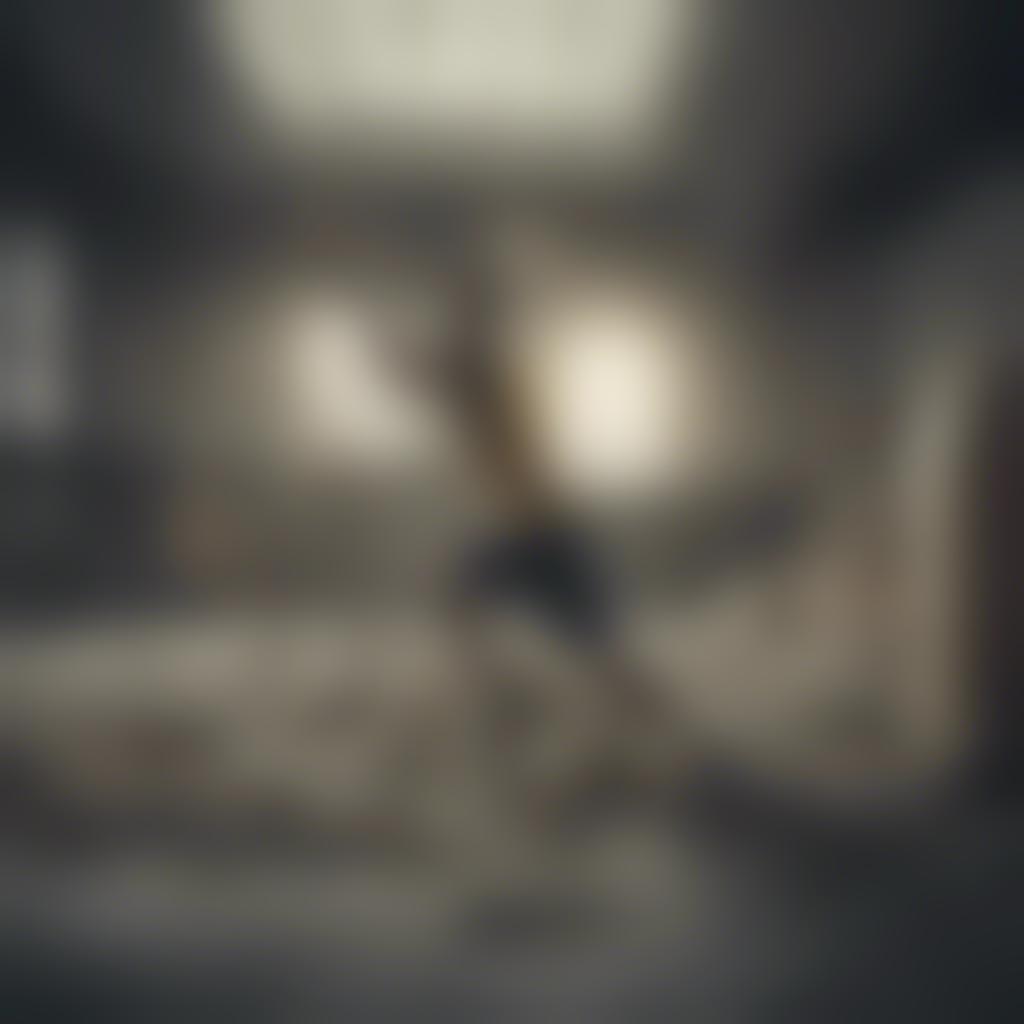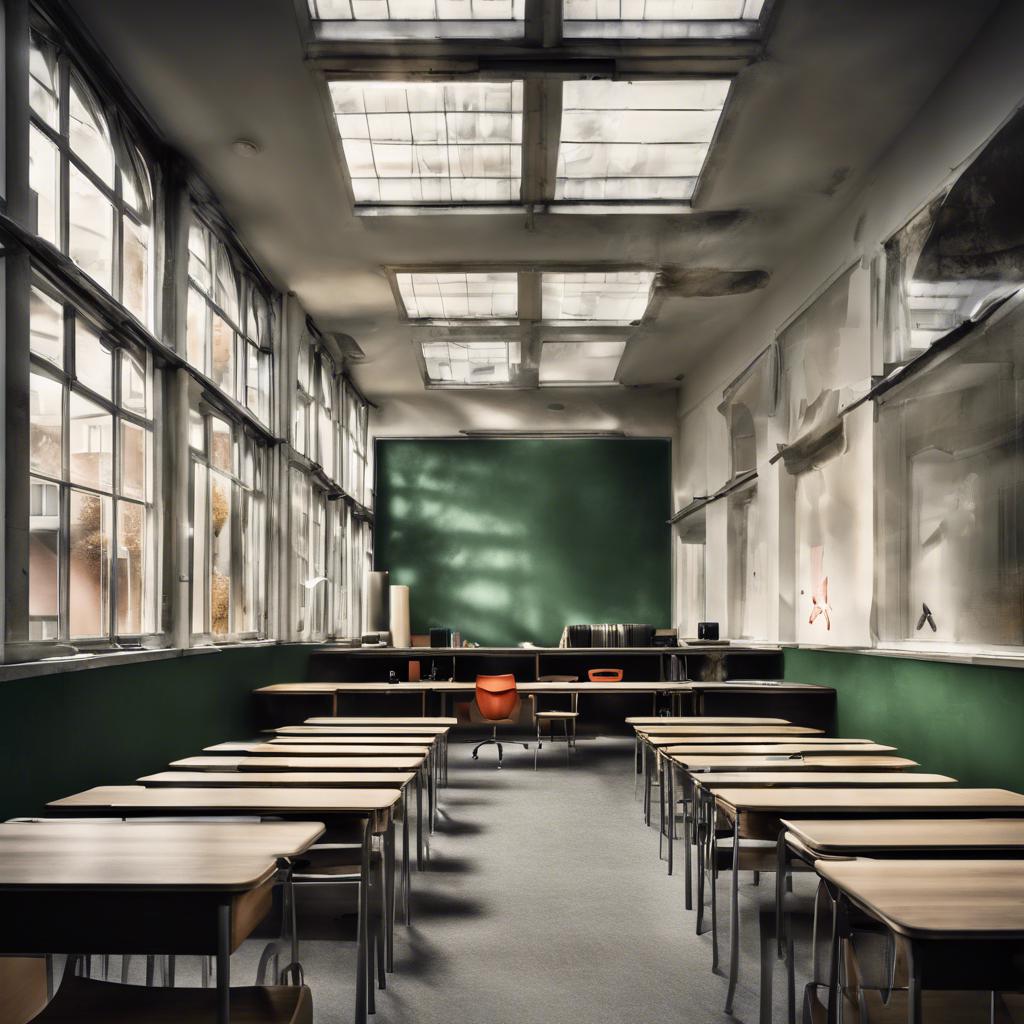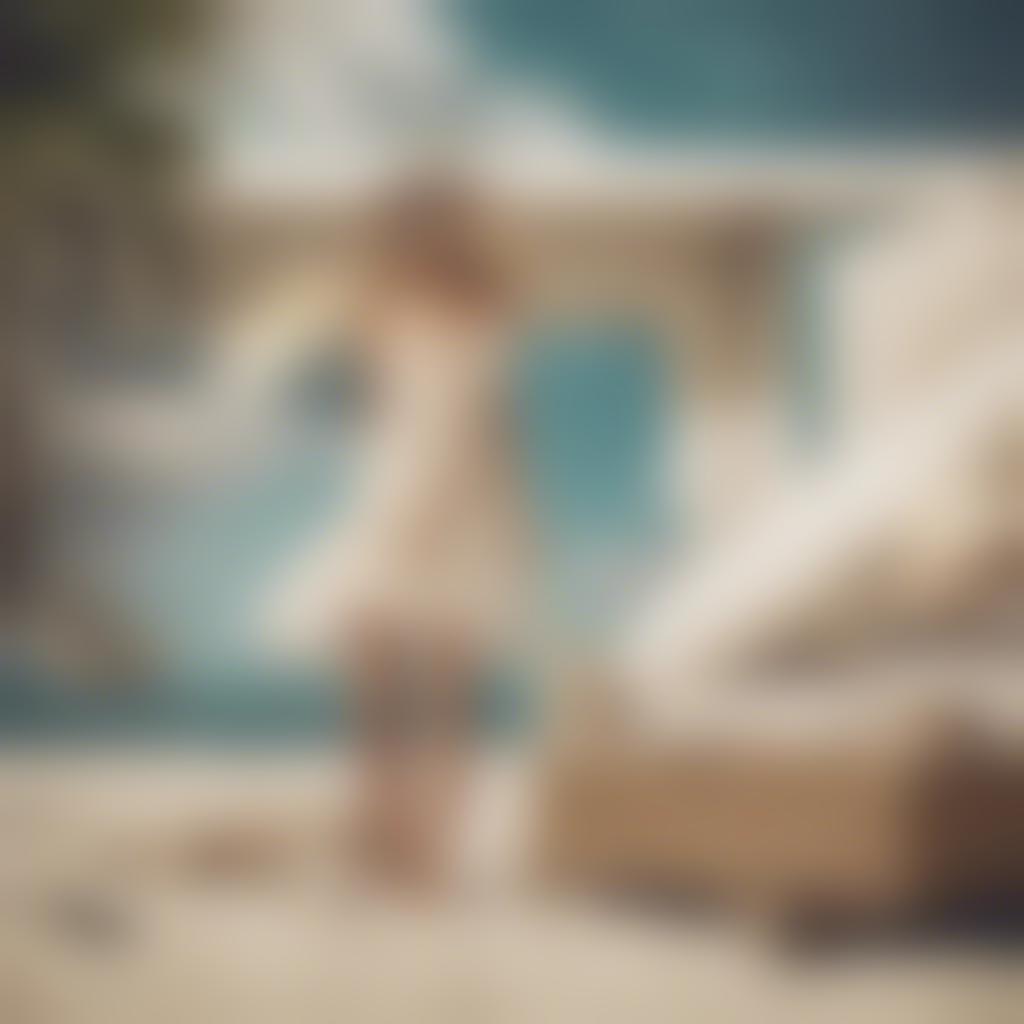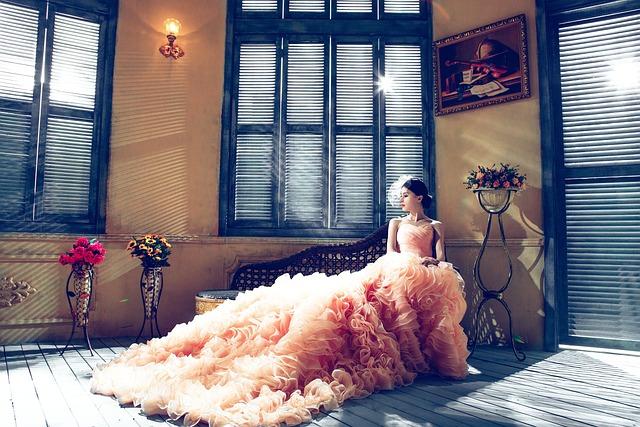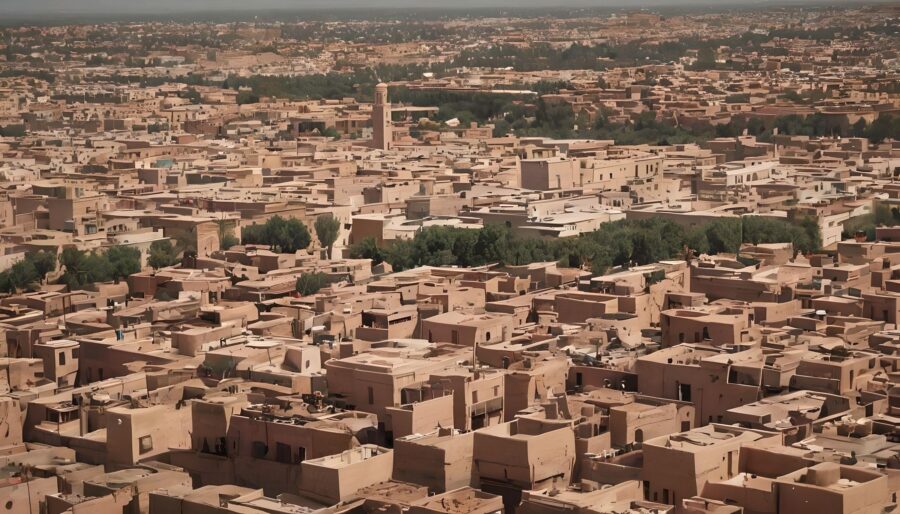Luxusaktien 2025 im Vergleich – Wendepunkt des Luxusmarkts steht bevor

Der Luxusmarkt steht 2025 an einem entscheidenden Wendepunkt. Während einzelne Marken Rekordmargen und volle Auftragsbücher melden, kämpfen andere mit sinkender Nachfrage, Designproblemen und wachsender Skepsis an den Kapitalmärkten. Ferrari, Hermès und Kering zeigen exemplarisch, warum „Luxus“ an der Börse nicht gleich „Luxus“ ist – und weshalb Investoren genau unterscheiden müssen, in welche Geschäftsmodelle sie ihr Vertrauen setzen.
Der globale Luxusmarkt 2025 unter Druck
Nach Jahren des Wachstums sieht sich die Branche mit Gegenwind konfrontiert. Marktstudien prognostizieren für 2025 einen Rückgang der weltweiten Umsätze bei persönlichen Luxusgütern von bis zu neun Prozent im Negativszenario. Auch die geopolitische Lage und die von den USA verhängten Zölle von 15 Prozent auf europäische Waren belasten die Branche. Viele Marken haben darauf mit moderaten Preiserhöhungen reagiert, um ihre Margen zu sichern. Gleichzeitig bleibt der Tourismus ein wichtiger Treiber: Die internationalen Ankünfte haben fast das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht und sollen 2025 sogar leicht darüber hinausgehen.
Verschiebung der Kundensegmente
Besonders auffällig ist die Verschiebung innerhalb der Kundensegmente. Während sehr wohlhabende Konsumenten weiterhin bereit sind, hohe Preise für exklusive Produkte zu zahlen, zeigt sich im Bereich des „aspirational luxury“ eine wachsende Zurückhaltung. Analysten sprechen bereits von einer „Luxury Fatigue“, die sich insbesondere bei jüngeren, trendbewussten Käufern bemerkbar macht.
Ferrari – Luxus auf vier Rädern
Ferrari ist ein Sonderfall innerhalb des Luxussegments. Zwar handelt es sich um einen Automobilhersteller, doch die Marke wird an der Börse wie ein echtes Luxusunternehmen bewertet. Das liegt an der besonderen Geschäftslogik: Ferrari produziert grundsätzlich weniger Fahrzeuge, als die Nachfrage hergeben würde. Dieses Prinzip der Knappheit garantiert eine hohe Wertstabilität und sorgt für Margen, von denen andere Hersteller nur träumen können.
Im zweiten Quartal 2025 meldete Ferrari einen Umsatzanstieg von vier Prozent auf 1,787 Milliarden Euro. Das EBITDA stieg um sechs Prozent auf 709 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag bei 30,9 Prozent. Noch wichtiger für Anleger ist das volle Auftragsbuch: Bestellungen sind bis 2027 gesichert. Für bestimmte Modelle wie den 296 Speciale oder den Purosangue berichten Kunden von extremen Wartelisten, teilweise sogar geschlossenen Orderbüchern. In Foren ist von „Scarcity by time“ die Rede – Exklusivität entsteht nicht nur durch Stückzahlen, sondern auch durch eine zeitlich limitierte Verfügbarkeit.
Ferrari und die Elektromobilität
Eine spannende Debatte betrifft die Rolle der Elektromobilität. Während der Konzern an seinem ersten vollelektrischen Modell arbeitet, äußern viele Fans in sozialen Medien Skepsis. Manche Beiträge behaupten, geplante EV-Modelle seien verschoben worden, weil die Nachfrage nicht den Erwartungen entspricht. Offiziell bestätigt ist das nicht, doch die Diskussion zeigt, dass Ferrari in einer Balance zwischen Tradition und Zukunft steht.
Warum wird Ferrari an der Börse wie ein echtes Luxusunternehmen bewertet?
Die Antwort liegt in der Mischung aus Preismacht, Markenidentität und langfristiger Planung. Mit einem Forward-KGV von über 40 wird Ferrari klar oberhalb klassischer Autohersteller bewertet. Analysten verweisen auf die Sichtbarkeit der Umsätze über Jahre hinweg und die bewusst gesteuerte Knappheit. Damit gleicht Ferrari eher einem Modehaus wie Hermès als einem Autokonzern.
Hermès – Stabilität durch Handwerk und Knappheit
Hermès ist für viele Investoren der Inbegriff von Luxus. Mit ikonischen Produkten wie der Birkin oder Kelly Bag und einer kompromisslosen Qualitätspolitik schafft es das Unternehmen, die Nachfrage dauerhaft über dem Angebot zu halten. Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sprechen für sich: Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 8,03 Milliarden Euro, die operative Marge lag bei 41,4 Prozent – ein Spitzenwert in der gesamten Branche.
Besonders interessant ist die Preispolitik. Hermès hat 2025 die Preise global um etwa sieben Prozent angehoben, in den USA kamen durch Zölle zusätzliche Erhöhungen hinzu. Nutzerberichte in einschlägigen Foren schildern Preisaufschläge von mehreren hundert Dollar selbst bei kleineren Taschenmodellen. In Kombination mit restriktiven Verkaufspraktiken – Prespend-Anforderungen, Lotteriesysteme in Paris und der Ausschluss von Touristen bei Quota-Bags – entsteht ein Gefühl der Exklusivität, das die Marke nachhaltig stützt.
Prespend und Kundenfrust
In Online-Diskussionen wird häufig über das sogenannte Prespend gesprochen. Kunden berichten, dass ein reines 1:1 Prespend, also der Kauf anderer Produkte im gleichen Wert wie eine gewünschte Tasche, oft nicht ausreiche. Teilweise wird sogar ein Wohnort in der Nähe der Boutique als Bedingung genannt, um eine Birkin oder Kelly angeboten zu bekommen. Diese restriktiven Regeln sind nicht unumstritten, stärken aber den Nimbus des Unerreichbaren.
Weshalb rechtfertigt Hermès ein deutlich höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis als Kering?
Die Antwort ist einfach: Hermès ist weitgehend unempfindlich gegenüber Konjunkturschwankungen. Die Nachfrage im Ultra-High-End-Segment bleibt stabil, und durch die limitierte Produktion sind die Margen abgesichert. Mit einem Forward-KGV von rund 47 bis 49 wird die Aktie zu einer Prämie gehandelt – ein Wert, den Investoren für Qualität und Beständigkeit zu zahlen bereit sind.
Kering – Die Last von Gucci
Ganz anders sieht die Situation bei Kering aus. Der Konzern kämpft mit einem deutlichen Umsatzrückgang, insbesondere bei seiner Leitmarke Gucci. Im zweiten Quartal 2025 sanken die Erlöse um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro, Gucci allein verlor 25 Prozent. Damit wird deutlich: Kering ist stark von einer Marke abhängig, deren Strahlkraft nachgelassen hat.
In sozialen Medien und Foren ist häufig von einer „Abkühlung“ der Marke die Rede. Das Konzept des „Quiet Luxury“, also leiser, unauffälliger Eleganz, dominiert derzeit die Modewelt. Gucci hingegen steht weiterhin für auffällige Designs, die viele Kunden zunehmend als überholt empfinden. Hinzu kommt ein hoher Verschuldungsstand von 9,5 Milliarden Euro sowie eine Herabstufung des Ausblicks durch Ratingagenturen.
Kreativwechsel als Hoffnungsschimmer
Einige Investoren sehen in der Ernennung von Luca de Meo zum CEO ab September 2025 einen Wendepunkt. De Meo gilt als erfahrener Manager, der mit klarer Linie und strategischem Fokus Unternehmen erfolgreich neu positionieren kann. Doch es bleibt unklar, ob er das Imageproblem von Gucci schnell lösen kann.
Warum stürzt Gucci – und damit Kering – im Gegensatz zu Hermès ab?
Die Ursachen sind vielschichtig: Eine schwankende Designsprache, geringe Kundentreue und die Abhängigkeit von der chinesischen Nachfrage haben Gucci verwundbar gemacht. Während Hermès auf Handwerk und Knappheit setzt, muss Gucci ständig mit neuen Kollektionen überzeugen. In Zeiten schwächerer Konsumlaune ist dieses Modell riskant.
China, Resale und die neue Marktlogik
China bleibt ein entscheidender Faktor für den globalen Luxusmarkt. Prognosen deuten auf eine flache Entwicklung 2025 hin, während parallel der Secondhand-Luxusmarkt boomt. Plattformen wie The RealReal und Vestiaire Collective melden zweistellige Wachstumsraten. Besonders bemerkenswert: Einige Gucci-Modelle sind im Wiederverkauf gefragt, obwohl die Marke im Retail schwächelt. Dieses Paradox zeigt, wie komplex die Markenwahrnehmung geworden ist.
Welche Rolle spielt die Schwäche im Luxusmarkt in China für Marken wie Kering?
Für Kering ist die Entwicklung in China besonders kritisch. Dort ist das Unternehmen stark auf jüngere, modetrendgetriebene Kunden angewiesen. Im Gegensatz zu Hermès, das von Ultra-High-Net-Worth Individuals getragen wird, trifft die Konsummüdigkeit Kering besonders hart.
Unterschiedliche Bewertungen – ein Blick auf die Zahlen
Die folgende Tabelle zeigt, wie unterschiedlich Ferrari, Hermès und Kering aktuell dastehen:
| Merkmal | Ferrari | Hermès | Kering / Gucci |
|---|---|---|---|
| Kernlogik | Knappheit, Wartelisten | Ultra-High-End, limitierte Produktion | Modezyklen, Trendabhängigkeit |
| Aktuelle Kennzahlen | EBIT-Marge 30,9 %, Umsatz +4 % | Operative Marge 41,4 %, Umsatz +8 % | Umsatz –15 %, Gucci –25 % |
| Bewertung (Forward-KGV) | Über 40 | 47–49 | 33 |
| Nachfragequalität | Sammler- und Sammlermarkt | UHNW-Kunden, Resale-Stärke | Aspirational, konjunktursensibel |
Kann man Luxusaktien trotz Marktschwäche heute noch als attraktiv einschätzen?
Trotz der momentanen Unsicherheit sehen einige Analysten Chancen. Historisch betrachtet bietet der Sektor in Krisenzeiten oft günstige Einstiegspunkte. Marken mit stabiler Preismacht wie Hermès und Ferrari gelten als besonders attraktiv. Kering dagegen ist eine Turnaround-Wette – mit höheren Risiken, aber auch einem möglichen Aufholpotenzial, falls Gucci wieder an Popularität gewinnt.
Die aktuelle Situation zeigt, dass Luxus an der Börse nicht gleich Luxus ist. Ferrari profitiert von seinem einzigartigen Geschäftsmodell, Hermès überzeugt mit unerschütterlicher Preismacht und Handwerkskunst, während Kering und Gucci um ihre Position kämpfen. Für Anleger bedeutet das: Es reicht nicht, einfach in „Luxus“ zu investieren. Entscheidend ist, die Unterschiede zwischen den Geschäftsmodellen zu verstehen und die Bewertungen im Kontext zu betrachten. Wer heute auf Luxusaktien setzt, investiert nicht nur in Produkte, sondern in Strategien – und die unterscheiden sich bei Ferrari, Hermès und Kering fundamental.